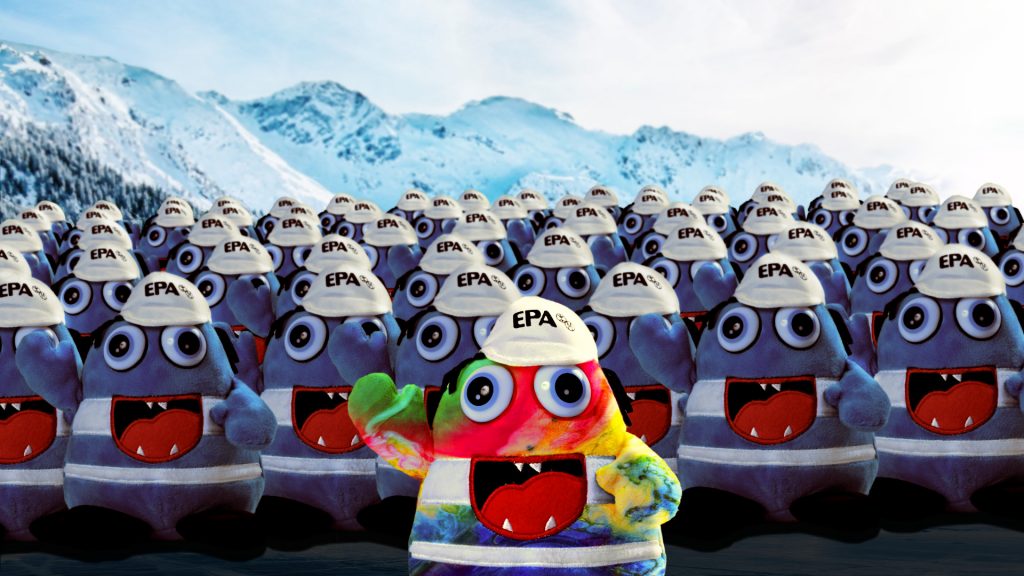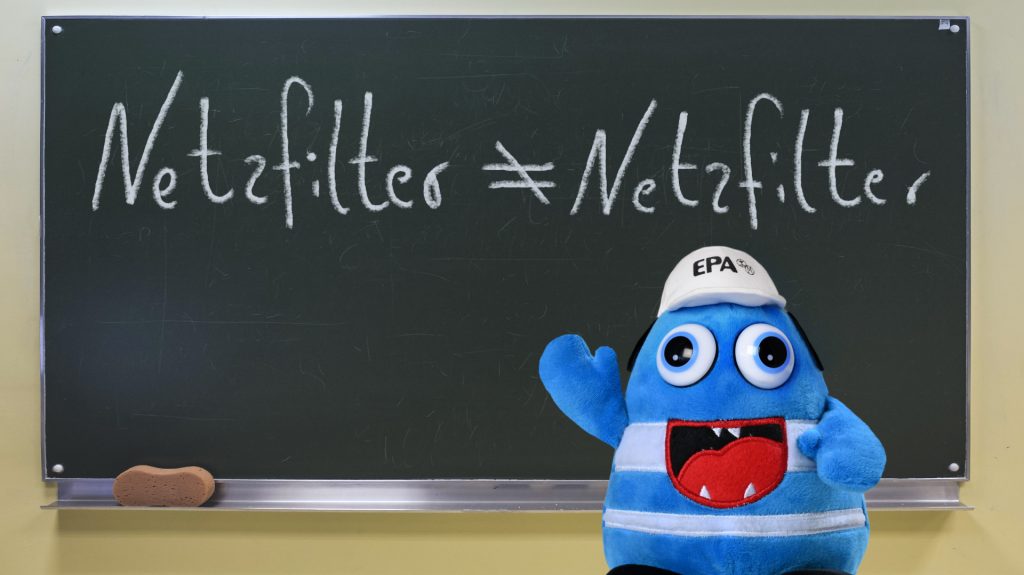Viele werden es kennen: Heimelektronik-Komponente X ist in die Jahre gekommen, verweigert die Zusammenarbeit mit der gerade eben neu angeschafften Peripherie, bekommt keine Sicherheitsupdates mehr oder hat schlicht und ergreifend das Zeitliche gesegnet. Gelockt von den Werbeversprechen des Herstellers eines reibungslosen Austauschs wird ein – nicht selten deutlich neueres – Austauschgerät angeschafft, installiert und … natürlich hakt es an allen Ecken und Enden. Dass solch eine Aktion reibungslos verläuft, ist eine Seltenheit.
Und auch in der Antriebstechnik ist es nicht viel anders.
Die enorm breit gefächerte Liste von Anforderungen an einen Antriebsregler macht es für die Hersteller selbiger nahezu unmöglich, Geräte zu bauen, deren Austausch man als Plug-and-play bezeichnen könnte. Diese Geräte müssen vielmehr einen möglichst großen Einsatzbereich abdecken.
Kommt es nun zum Fall der Fälle und in einer Anlage muss ein (oder unter Umständen sogar mehrere) Antriebsregler ausgetauscht werden, bedeutet das für den Endanwender, dass diese universellen Geräte erst einmal auf seine spezifischen Anforderung hin angepasst werden müssen. Diese Anpassung betrifft unter anderem die Beschaltung der Ein- und Ausgänge, aber noch sehr viel mehr das Programmieren der Parameter.
Wer sich selbst schon einmal durch Parameterlisten-Dschungel der Handbücher gekämpft hat, weiß, wie sehr man sich in solch einer Situation einen fachkundigen Guide gewünscht hat.
Die EPA GmbH ist genau dieser Guide! Mit unserem Parametrierservice ab Werk erhalten Sie auf Wunsch Ihre Geräte komplett konfiguriert, vorparametriert und auf Ihre Anwendung abgestimmt.
Aber nicht nur bei einem Eins-zu-eins-Austausch mit baugleichen Geräten, auch bei einem Retrofit, einer Modernisierung Ihrer Antriebstechnik bieten wir Ihnen diesen Service.
Bei einem Beispiel aus der Praxis sollten vier Frequenzumrichter vom Typ Commander SK auf ein aktuelles Modell umgebaut werden. Die Anbindung sowie die Anwendung sollten jedoch identisch bleiben.
In Zusammenarbeit mit unserem Team aus der Antriebstechnik wurden für die Umrüstung die Modelle M400 inklusive passender EMV-Unterbaufilter ausgewählt.
Die Parameter der alten Geräte wurden ausgelesen und in unserer Antriebsabteilung auf die neuen Geräte übertragen, bevor sie ausgeliefert wurden.
Nach dem Einbau Frequenzumrichter an ihrem Bestimmungsort waren alle Tests – inklusive der komplexen Profibus-Anbindung – ohne weitere Anpassungen auf Anhieb erfolgreich.
Plug-and-play, wie es sein sollte!